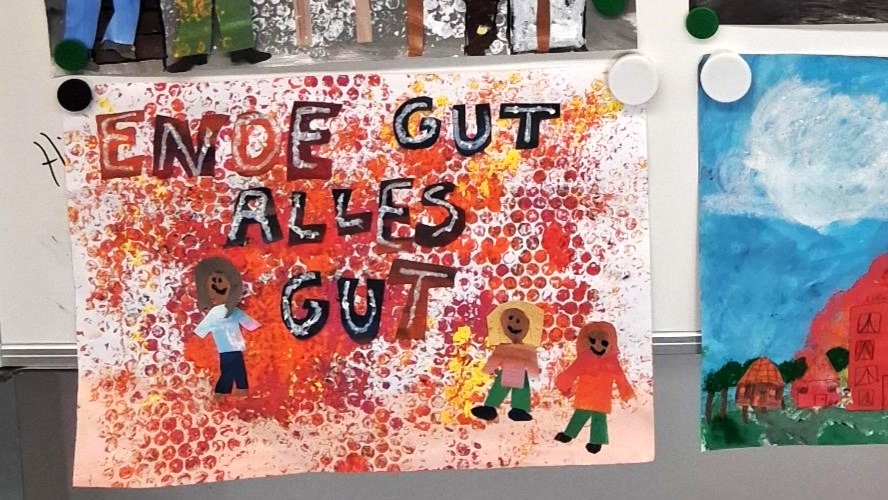Seit einem Jahr unterstützt Dorota Trynks nun die Pädagogische Werkstatt in der Neubrandenburger Oststadt. Wie blickt sie auf Ein Quadratkilometer Bildung?
Dorota, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Die kurze Antwort: jeden Tag anders! Als Pädagogische Werkstatt begleiten wir nicht nur große und kleine Prozesse in unterschiedlichen Phasen, sondern auch verschiedene Arbeitsgruppen auf unterschiedlichen Ebenen, und das an den Schulkalender angepasst. Die Aufgaben sind komplex, deswegen sieht kein Tag gleich aus: Absprachen mit Kooperationspartner:innen treffen, Bedarfe identifizieren, Ideen entwickeln, recherchieren, Arbeitstreffen und Veranstaltungen vorbereiten, moderieren oder durchführen, ihre Ergebnisse für alle transparent machen, Partner:innen bei ihren Vorhaben unterstützen… Jeder Tag ist eine bunte Mischung von all dem und man jongliert mit allen Themen gleichzeitig. Meine bisherige Berufserfahrung hilft mir dabei sehr. Jahrelang habe ich in Polen Deutsch unterrichtet, komme also aus dem schulischen Kontext, bin auch Lerncoach und bringe Erfahrungen aus dem Bereich der Neurodidaktik und aus früheren Sprach- und Lernprojekten in der Grenzregion mit. Diese Erfahrungen kann ich in meinen jetzigen Berufsalltag in Neubrandenburg miteinfließen lassen.
Was macht km2 Bildung Neubrandenburg für dich aus?
Die zunehmende Zahl von Kriegen in der Welt und der Lockdown während der Corona-Pandemie hatten und haben enorme Auswirkung auf gesellschaftliche Entwicklungen. Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, Superdiversität, Globalisierung, Ökologie in Zeiten des Klimawandels, und, und, und. Tagtäglich werden wir mit diesen Herausforderungen konfrontiert. Ein Quadratkilometer Bildung ist für mich ein Versuch, trotz solcher Herausforderungen Kindern gute Bildung zu ermöglichen, und zwar unabhängig von ihrer Herkunft und sozialen Lage.
Die Bildungsbiografie jedes einzelnen Kindes ist ausschlaggebend für seine Lebensbiografie. Gleichzeitig ist es illusorisch zu glauben, dass die Schule es alleine schafft, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Da müssen alle mitwirken, die die Kinder auf verschiedenen Bildungsstufen begleiten. Es braucht Mut die realen Bedarfe zu identifizieren, sich zu öffnen, Expertisen einzuholen, Synergieeffekte zu erzeugen. Mich lässt der Gedanke nicht los, dass es ein Privileg ist, mit den Akteur:innen vor Ort an diesen Aufgaben arbeiten zu können.
Wie funktioniert ein gutes Bildungsnetzwerk?
Vertrauen und Verlässlichkeit, Offenheit und Diversität, gemeinsame Ziele und Werte, eine gute Balance zwischen Geben und Nehmen und zwischen Struktur und Flexibilität. Das sind Begriffe, die mir sofort in den Sinn kommen, wenn ich an Netzwerkarbeit denke. Auch eine gute Fehlerkultur gehört für mich unbedingt dazu. Damit meine ich die Annahme, dass alle Beteiligten gute Intentionen haben, sowie die Bereitschaft, auch über unbequeme Themen zu reden. Ein Netzwerk kann etwas erreichen, wenn alle Beteiligten Lust auf gemeinsames Tun und auf gemeinsames Scheitern haben. Frei nach dem Motto: Lasst uns gemeinsam etwas ausprobieren, viele Fehler machen, sie schnellstmöglich reflektieren und daraus lernen.